Der Streit um Traditionen und Erneuerungen schwelt schon gefühlt ewig. Orgel oder Band? Sonntagmorgen oder Sonntagnachmittag? Kindstaufe oder Glaubenstaufe? Talar oder lässiges Outfit? Priestertum oder Priestertum alle Gläubigen? Geh aus mein Herz oder Heart of Worship? Tradition oder Innovation?
Lange wurden diese Diskussionen vor allem innerkirchlich geführt. Spannend ist, dass es nun auch immer mehr Stimmen aus Wirtschaft und Gesellschaft gibt, die in die Diskussionen einsteigen. Das Buch „Exnovation und Innovation“ wurde zwar unter anderen von der Theologin Sandra Bils (in Zusammenarbeit mit der Organisationspsychologin Gudrun Töpfer) geschrieben, erschien jedoch in dem wirtschaftswissenschaftlichen Fachverlag Schäffer & Poeschel. Die beiden Autorinnen greifen dabei immer wieder auf Beispiele aus der Wirtschaft zurück; auch wenn sich ein komplettes Kapitel um Exnovation und Innovation in kirchlichen Kontexten dreht.
Tradition und Innovation: (k)ein Dilemma
Eine weitere Stimme kommt nun von Wolfgang L. Brunner, promovierter Betriebswirtschaftler und ehemaliger langjähriger Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. In seinem Essay „Tradition oder Innovation. Ein Dilemma, das keines sein sollte“, führt er aus, wie sehr Gesellschaften auf Traditionen fußen, sich aus ihnen heraus bilden und diese weiterentwickeln müssen: „Das Verharren auf dem Status quo führt unweigerlich zu einer Verringerung des Wohlstands, da Chancen der Zukunft nicht wahrgenommen werden.“ (S. 13) Es braucht also eine Transformation der Tradition. Keine Aushebelung, keine reine Abschaffung von Tradition, denn dies könnten „tiefgreifende Folgen für eine Gesellschaft haben. Da Traditionen einen wesentlichen Teil der kulturellen Identität einer Gemeinschaft ausmachen, spiegeln sich deren Geschichte, Werte, Normen und Bräuche wider.“ (S. 17) Was zunächst wie ein vermeintliches Loblied auf Traditionen klingt, bringt spätestens im zweiten Kapitel auch die Erkenntnis mit sich: Traditionen sind nicht festgelegt und in Stein gemeißelt. Sie dürfen, sie müssen und sie werden sich verändern. Auch er erklärt, wie Bils und Töpfer, dass jedoch mächtige Beharrungskräfte am Werk sind, dass Menschen, dass Gesellschaften, Veränderungen meist nur in kleinen Dosen akzeptieren und nicht die großen, allumfassenden Änderungen über Nacht herbeisehnen. Es braucht Innovation als Schlüssel für eine zukunftsfähige Gesellschaft, ja, aber schrittweise. „Innovationen markieren einen Bruch mit der Vergangenheit und weisen einen Weg in die Zukunft“, schreibt Brunner auf S. 30. Innovationen markieren aber auch einen Bruch mit Traditionen. Denn wenn Traditionen nicht mehr tragen, braucht es Innovationen, die sie verändern, adaptieren, in eine Zukunft hineinführen. Wann dieser Zeitpunkt gekommen ist, weiß Brunner auch: „Eine Tradition gilt als überkommen, wenn ihre Gewohnheit die ursprüngliche Bedeutung und Relevanz verloren hat. Dann dient eine Tradition nur noch als leere Hülle, die zur Aufrechterhaltung einer äußeren Form beibehalten wird, ohne dass die tieferen Werte oder Überzeugungen, die einst damit verbunden waren, noch verstanden oder geteilt werden.“ (S. 80)
Anhand vieler Beispiele aus der Wirtschaft (Leberkässemmel und bayrische Wirtshäuser – überhaupt sehr viel bayerische Beispiele) beschreibt Brunner, wie sich Traditionen gebildet, verändert oder gestärkt haben und er lobt die Fähigkeit kleiner mittelständischer Unternehmen (KMU), sich im Spannungsfeld zwischen Traditionen (z.B. als familiengeführtes Unternehmen den Familienwerten und -traditionen verpflichtet) und Innovation zu bewegen.
Tradition und Innovation in Kirche
Doch was hat das alles mit Kirche zu tun? Neben religiösen Beispielen (der Tradition der Weihnachtsmärkte und Osterbräuche oder die Abschaffung des traditionellen Buß- und Bettags als Feiertag), lassen sich viele Erkenntnisse, die Wolfgang L. Brunner in seinem Essay beschreibt, auch auf die Kirche und religiöse Gemeinschaften übertragen. Wie etwa: „Das Festhalten an Traditionen und Bräuchen trägt dazu bei, dass eine Gesellschaft eine gemeinsame Identität und ein Gefühl von Zusammenhalt entwickelt. Menschen fühlen sich miteinander verbunden, wenn sie ihre Traditionen und Bräuche pflegen und teilen.“ (S. 108f.) Oder kirchlich formuliert: Der Klang der Orgel, die Zeilen alter, bekannter Kirchenlieder, die Liturgie, das Feiern von Sakramenten, so wie sie „schon immer“ gefeiert wurden – all das erzeugt Vertrautheit, ein Gefühl von Sicher- und Geborgenheit, so etwas wie Heimat. Dessen muss man sich in allen Diskussionen um Veränderungen, um Erneuerungen, um Anpassungen immer wieder bewusst sein. Menschen haben ein tiefes Grundbedürfnis nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach Anerkennung. Diesem nachgeordnet erscheinen da Bedürfnisse nach Kreativität, Fortschritt und Wissen.
Brunner plädiert dafür, Tradition und Innovation nicht als Gegensätze anzusehen, „sondern vielmehr als dynamische Konzepte, die sich gegenseitig ergänzen und bereichern können.“ Wo ist es sinnvoll, sich auf Bewährtes zu stützen. Wo stehen Rituale und Traditionen im Weg? Wo sehnt sich Gemeinde nach Neuerungen, nach einem „frischen Wind“, nach Mut und Risiko, nach Ausprobieren? Tradition ist in diesem Konstrukt so etwas wie die Grundlage, das Fundament; verleiht Stabilität, Sicherheit und Orientierung. Darauf kann dann Innovatives ausprobiert und aufgebaut werden, als Raum für Weiterentwicklung. Aber auch das gelingt nur, wie so vieles im Leben, in Balance. Wie eine Wippe, die mal in die eine, mal in die andere Richtung kippt, im besten Fall aber beide Seiten auf gleicher Höhe hält. Und vielleicht auch im Sinne einer – kirchlich gedachten – Mixed Economy, wo sich traditionelle und frische Formen von Kirche nebeneinander stehend ergänzen – nicht bekämpfen. Und vielleicht auch im Hinblick darauf, wie Oscar Wilde einst Tradition und Innovation zusammenfasste, den Brunner in seinem Essay zitiert: „Tradition ist eine Erfindung [oder eine Innovation, Anm. d. Aut.], die Erfolg hat.“ (S. 102)
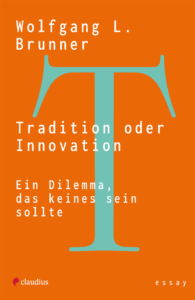
Wolfgang L. Brunner, Tradition oder Innovation. Ein Dilemma, das keines sein sollte“, 160 Seiten, erschienen 2025 im Claudius Verlag