Das Verblüffende bei den vielen Reformprozessen der evangelischen Landeskirchen ist: Sie werden von der Basis überwiegend als organisatorische und nicht als inhaltliche, geschweige denn als geistliche Prozesse erlebt. Um es sehr pointiert auszudrücken: Fast alle Zukunftsansätze scheinen nach dem Muster zu arbeiten „Wie können wir demnächst mit weniger Personal, weniger Geld und weniger Gebäuden das weitermachen … was jetzt auch nicht funktioniert?“ Sensationell, oder?
Anstatt die massiven Umbruchzeiten zum Anlass für eine Rundumerneuerung (oder gar einen Aufbruch) zu nutzen, wird versucht, die in vielerlei Hinsicht überholten Formen der Kirche strukturell am Leben zu erhalten. Da erstaunt es nicht, dass viele Gemeindeglieder ein wenig ratlos in die Zukunft schauen und überhaupt nicht wissen, was sie denn jetzt machen sollen.
Vermutlich, weil sie eines vorhersehen: Das Einrichten von Kooperations- und Nachbarschaftsräumen (das Zusammenfügen von Gemeinden zu größere Einheiten) beantwortet nicht wirklich die Fragen, mit denen die Kirche ringt. Es versucht nur, das Gewohnte effektiver zu gestalten. Konkret bedeutet das: Anstatt nur im System weiterzuwurschteln, sollten wir am System arbeiten.
Nun zeigt sich aber: Da, wo der (im Kern weiter von der Vergangenheit) bestimmte Reformansatz durch Innovationsbereitschaft ersetzt wird, entsteht eine mitreißende Start-up-Mentalität; und Start-ups werden ja vor allem mit flachen Hierachien, schnellen Prozessen und kurzen Feedback-Zyklen in Verbindung gebracht.
Vor allem zeichnen sich Start-ups in ihrem Teams durch den Unternehmergeist aus, der dort herrscht. Getreu dem biblischen Motto: „Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige! Denn siehe, ich will ein Neues schaffen.“ (Jes 43,18) Übrigens meint das Wort „Start-up“ im Englischen „etwas in Gang setzen“. Was für Kirche ja nie falsch sein kann.
Für Menschen mit Unternehmergeist, die transformativ denken (also: Veränderung und Weiterentwicklung nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung ansehen), geht es (wie in einer Bewegung) darum, die Prozesse von den Zielen her zu denken – und das mit Freude an neuen Ausdrucksformen: „Lasst uns Kirche doch mal ganz anders denken.“
Um das herunterzubrechen: Wenn eine Gemeinde ihre Gottesdienste abends um 21 Uhr in der Kneipe feiert, ihr Gemeindehaus tagsüber als Co-Working-Space zur Verfügung stellt, einen Exit-Room zur nächsten Predigt entwickelt, eine Hauptamtliche für die Begleitung der Freiwilligen einstellt, den von der Schließung bedrohten Kiosk am Marktplatz übernimmt oder jeden Mittwoch die Mitarbeitenden des Autozulieferers um sechs Uhr zum Auftanken einlädt, dann beweist sie Unternehmergeist.
Vor allem dann, wenn sie diese Angebote nicht als Add-ons, also als zusätzliche Termine präsentiert, sondern für den Kneipengottesdienst den „normalen“ Gottesdienst ausfallen lässt: Es findet ja ein Gottesdienst statt … nur eben „Im Löwen“. Zu echtem Unternehmergeist, der „Innovationen“ fördern will, gehört deshalb auch ein Gefühl für „Exnovation“ – für das, was man lassen will. Wozu wir an dieser Stelle ausdrücklich ermutigen: Wer Kirche nach vorne bringen will, sollte nicht mehr machen, sondern das Richtige. Und wer Neues wagen will, muss dafür Altes lassen: Keine Innovation ohne Exnovation. Allein, um für das Neue Energie zu habe. Eine Haltung, die schon die Mystiker kannten: „Gelassenheit“: „Gelassen“ ist derjenige, der alles lässt, was ihn vom Wesentlichen ablenkt.
Die deutsche Fresh X-Bewegung (nach dem anglikanischen Konzept der „Fresh Expressions of Church“ = frische Ausdrucksformen von Kirche) beweist seit Längerem Unternehmergeist, weil sie es wagt, Kirche neu von den vielfältigen Lebenswelten her zu denken … und weil sie – wie Unternehmer – als Erstes fragt: Was braucht denn meine Zielgruppe? Womit kann ich den Menschen in meiner Umgebung etwas Gutes tun?
Das bedeutet: Zu einer Start-up-Mentalität gehört auch die „Marktanalyse“ – in unseren Institutionen würden wir wohl eher sagen: das Hinhören. Das Zuhören. Das Nachhaken. Um dann zu entdecken, dass das ohnehin eine Grundlage des Glaubens ist: Er nimmt die Bedürfnisse der Menschen wahr. Getreu der Frage Jesu: „Was willst du, was ich für dich tun soll?“ (Mk 10,51)
Dabei zeigt die Erfahrung: Während es meinst mühsam ist, für klassische Aufgabenfelder Ehrenamtliche zu gewinnen, engagieren sich Menschen gerne, wenn sie spüren: „Hier wird etwas für unseren Ort getan.“ Menschen spüren, wenn sie nur den kirchlichen Laden am Laufen halten sollen. aber selbst Frauen und Männer, die sich gar nicht als Christinnen oder Christen bezeichnen würden, lassen sich motivieren, wenn ein Projekt eine diakonische Dimension hat, die die Lebensqualität fördert.
Studien haben zudem gezeigt: Fast immer erleben Menschen, wie gut es tut, zu einer geistlichen Gemeinschaft zu gehören, bevor sie auch den dazugehörigen Glauben für sich entdecken. Im Englischen wird dieses Phänomen mit den Worten „Belonging before believing“ bezeichnet. „Dazugehören kommt vor Glauben.“ Das heißt: Da, wo wir als Start-up-Kirche attraktive und passende Angebote zur Gemeinschaftsstiftung machen, entsteht auch ein Klima für geistliche Gemeinschaft.
Kirche, die wie ein Start-up Unternehmergeist entwickelt, fängt an, fantasievoll und von den Menschen her zu denken: So entsteht Innovation.
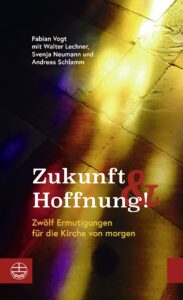
Dieser Beitrag ist ein Auszug aus dem Buch „Zukunft & Hoffnung! Zwölf Ermutigungen für die Kirche von morgen„, geschrieben von Fabian Vogt mit Walter Lechner, Svenja Neumann und Andreas Schlamm, erschienen in der Evangelischen Verlagsanstalt, Leipzig.